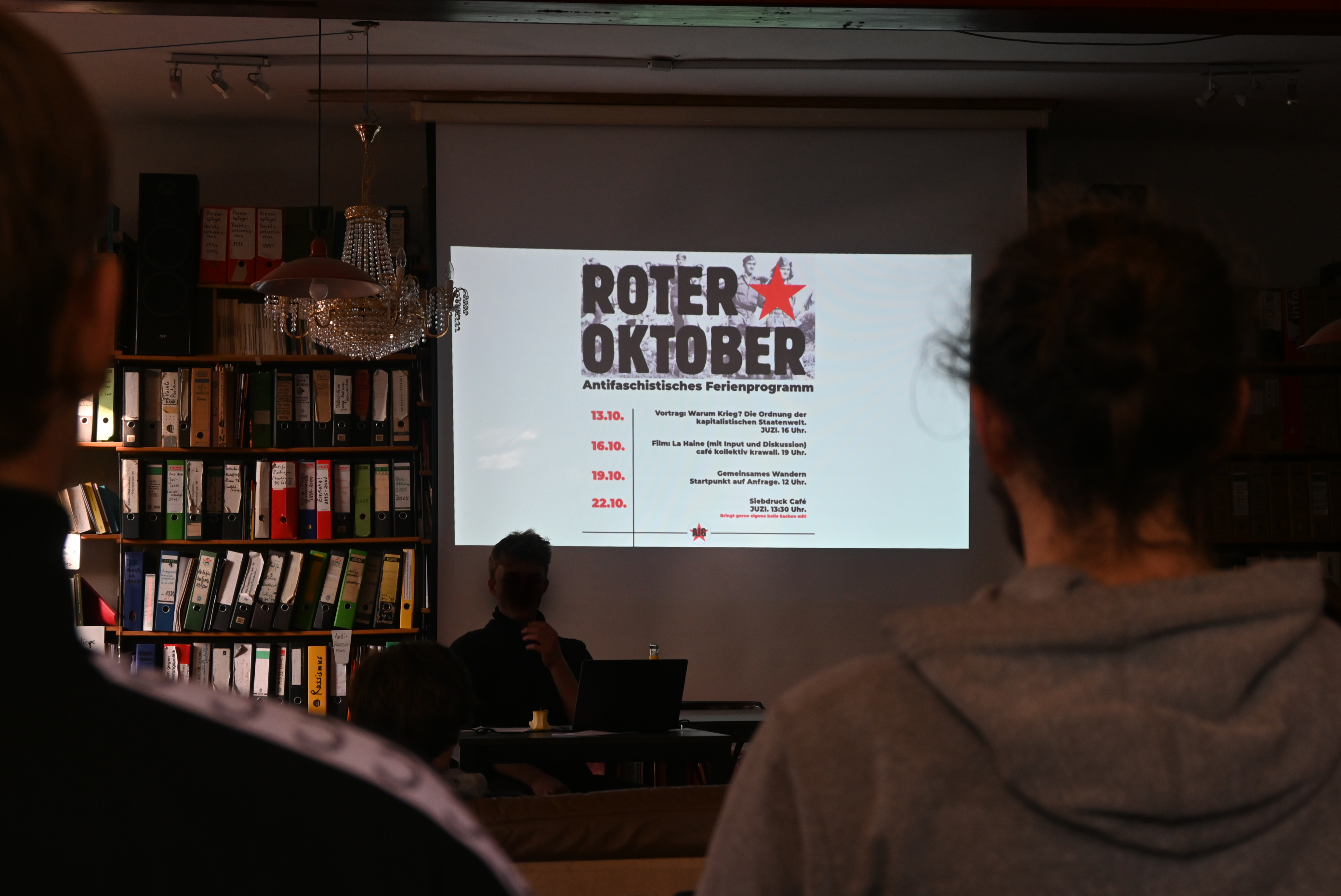Vorwort
Damit am Ende keine enttäuschten Gesichter zurückbleiben, will ich gleich zu Beginn klarstellen, worum es heute geht – und worum nicht. Es geht nicht um eine tagesaktuelle Analyse der Weltlage, nicht um eine Auflistung dessen, was der deutsche Staat außenpolitisch gerade unternimmt, und auch nicht um einen historischen Abriss, wie sich Weltmarkt und Imperialismus im Detail entwickelt haben.
Stattdessen soll es heute ganz grundlegend um etwas anderes gehen: Ich will bestimmen, warum Staaten überhaupt Imperialismus betreiben, was die grundlegenden Momente des Imperialismus sind, welche Widersprüche die Ordnung in diesem Weltmarkt bewegen und schließlich was Krieg und Frieden ausmacht.
Einleitung
„Das, was Russland da macht, ist Imperialismus! Und das wollen wir in Europa nicht!“ – so erklärte Olaf Scholz 2022 den Krieg in der Ukraine. Schon in diesem Satz steckt viel: Russland wird als Aggressor markiert, es „betreibt Imperialismus“. Der Begriff dient dabei nicht einer analytischen Bestimmung des russischen Staatswesens, sondern vor allem einer moralischen Abgrenzung. Denn das gute, friedliche Europa – so die Selbstdarstellung – würde so etwas natürlich nie tun. Es verteidigt, glaubt man den Politiker:innen, keine Interessen, sondern Werte; keine Macht, sondern Frieden.
Doch wie passt das zusammen mit einem Europa, das bis an die Zähne bewaffnet ist, in nahezu jedem globalen Konflikt politisch, wirtschaftlich oder militärisch mitmischt und zugleich seine „auf Frieden basierende Weltordnung“ als bedroht beklagt? Wenn Staaten, die ständig Kriege führen oder vorbereiten, von Frieden sprechen, lohnt sich ein kritischer Blick darauf, welche Art von Frieden hier eigentlich gemeint ist – und wer bestimmt, was als Imperialismus gilt und was nicht.
Tarek von K.I.Z. bringt diese Widersprüchlichkeit in einem Satz auf den Punkt:
„Wir sind gegen ihren Krieg und gegen ihren Frieden.“
Das Zitat enthält bereits die zentrale Einsicht, um die es heute gehen soll: In der kapitalistischen Staatenwelt sind Krieg und Frieden keine Gegensätze, sondern zwei Formen desselben Verhältnisses.
Kriege fallen nicht vom Himmel. Sie sind keine irrationalen Ausbrüche oder Launen einzelner Herrscher, sondern haben systematische Gründe. Dass sie weltweit permanent stattfinden – ob im Nahen Osten, in Afrika oder an den Grenzen des „friedlichen“ Europas – zeigt: Krieg gehört zur Normalität dieser Ordnung. Wenn also deutsche Politiker:innen heute klagen, unsere „auf Frieden basierende Weltordnung“ sei ins Wanken geraten, dann ist die eigentliche Frage:
Was für eine Ordnung ist das überhaupt? Was macht diesen Frieden aus – und warum produziert er immer wieder Krieg?
Genau das soll dieser Vortrag klären. Wer Kriege verstehen will, darf sie nicht nur moralisch ablehnen, sondern muss ihre Notwendigkeit aus der Logik kapitalistischer Konkurrenz begreifen. Privateigentum und Profitstreben zwingen jeden Staat, seine nationale Ökonomie zu sichern – nach innen wie nach außen. Daraus folgt unausweichlich die Konkurrenz der Staaten: Kooperation, solange die Interessen sich vereinbaren lassen – Konfrontation, sobald sie unvereinbar sind. Wo sich Gegensätze nicht mehr durch Handel, Verträge oder Diplomatie lösen lassen, entscheidet die Gewaltfrage – bis hin zum Krieg.
Meine Kernthese lautet daher:
Die Ordnung der kapitalistischen Staatenwelt ist nichts anderes als ein organisierter und hierarchisierter Imperialismus.
Krieg und Frieden sind darin zwei Seiten derselben Herrschaftsform: Der Frieden sichert die bestehende Gewaltordnung, der Krieg stellt sie offen wieder her.
Beides – der „Frieden“ der Unterdrückung und der Krieg zu ihrer Verteidigung – entspringt derselben Quelle: dem staatlichen Zwang, die Bedingungen kapitalistischer Ausbeutung zu schützen und auszudehnen. Eine Kritik am Krieg bleibt unvollständig, wenn sie den Frieden dieser Ordnung nicht ebenso infrage stellt.
Der bürgerliche Staat
Um zu begreifen, wieso Staaten Kriege betreiben, müssen wir uns zuerst ganz grundlegend diese anschauen. Auch wenn es viele verschiedene bürgerliche Staaten mit unterschiedlichen Herrschaftsformen, geografischer Lage und so weiter gibt, eint sie alle doch ihre Produktionsweise. Sie alle sind kapitalistische Staaten – und das ist hier auch maßgeblich.
Ideller Gesaamtkapitalist
Jeder bürgerliche Staat nutzt den Kapitalismus, um Geld und Macht zu vermehren. Darin liegt der Grund, weshalb er als ideeller Gesamtkapitalist bezeichnet wird.
Er vertritt nicht die partikularen Interessen einzelner Unternehmer oder Branchen, sondern ist in seinem eigenen Bestand vom Erfolg des gesamten nationalen Kapitals abhängig.
Damit dieses erfolgreich wachsen kann, garantiert er das Privateigentum durch sein Gewaltmonopol und setzt so die kapitalistische Produktionsweise allgemein durch. Darüber hinaus sorgt er für die Voraussetzungen der Kapitalverwertung:
Er baut Infrastruktur auf, organisiert ein Bildungswesen, das ständig neue Arbeitskräfte hervorbringt, und formt diese zugleich zu disziplinierten, produktiven Untertanen – und noch vieles mehr.
Damit gerät der Staat von Anfang an in ein widersprüchliches Verhältnis zu seinen Bürgern. Erst indem er Privateigentum und kapitalistische Produktionsweise allgemein durchsetzt, zwingt er alle, ihre gegensätzlichen Interessen in der Form des Tauschs von Eigentum – vermittelt durch Geld – auszutragen. Jeder muss seine Bedürfnisse auf dieser Grundlage verfolgen und ist dabei zugleich auf die Staatsgewalt angewiesen. Denn erst der Staat garantiert durch sein Gewaltmonopol das Privateigentum, auf das sich jeder bei der Durchsetzung seiner Interessen beruft und das er anderen doch allzu gern bestreiten würde.
Um diesen Widerspruch aufrecht zu halten, ist der Staat als souveräne Gewalt auf Mittel angewiesen. Er finanziert sich durch Steuern, Kredite und den Zugriff auf den gesellschaftlich produzierten Reichtum. Dieser Reichtum entsteht nicht einfach von selbst, sondern zweckmäßig aus dem Wachstum des Kapitals. Der Staat ist somit doppelt gebunden: Einerseits macht er durch die Garantie des Privateigentums und die Durchsetzung kapitalistischer Konkurrenz die Vermehrung von Kapital überhaupt notwendig; andererseits hängt sein eigener Fortbestand von diesem Wachstum ab.
Funktionsweise des Kapitals
Kapitalwachstum vollzieht sich nach einer eigenen Logik: Kapitalisten investieren ihr Eigentum in Produktionsmittel, Rohstoffe und Arbeitskraft.
Der Zweck dieses Einsatzes ist nicht bloße Reproduktion, sondern Vermehrung – aus G soll G′ werden.
Dieser Zweck wird von allen Kapitalisten privat gegeneinander verfolgt. Sie stehen im Zwang, ihre Waren gewinnbringend zu verkaufen und sich im Wettbewerb gegen andere Unternehmen durchzusetzen.
Die nationale Arbeitsteilung ist daher zwar in Form von Konkurrenz organisiert, bleibt aber dennoch eine Arbeitsteilung. Kein Unternehmen produziert für sich allein, sondern ist eingebunden in einen gesellschaftlichen Zusammenhang von Produktion, Zirkulation und Konsum. Mit der Entwicklung des Kapitalismus hat sich dabei der Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung immer weiter verschärft.
In den Anfängen kapitalistischer Produktion existierten noch kleinere Werkstätten oder Manufakturen, die einen Großteil des Produktionsprozesses eigenständig abwickelten. Eine Möbelmanufaktur etwa beschaffte das Holz, stellte die Nägel her und baute die Stühle vollständig selbst zusammen.
Heute ist die Produktion hochgradig spezialisiert. Unternehmen konzentrieren sich auf Teilbereiche oder einzelne Produktionsschritte, während die Herstellung eines simplen Produkts hunderte bis tausende Arbeitsschritte umfasst – verteilt auf zahlreiche Betriebe und Länder.
So sind Unternehmen in komplexe Lieferketten eingebunden, die sich zunehmend um große Konzerne und Monopole gruppieren. Jeder Betrieb ist vom reibungslosen Funktionieren dieser Netzwerke abhängig, zugleich aber gezwungen, sich gegen andere durchzusetzen.
Die Vergesellschaftung der Arbeit wächst also stetig, während die Ergebnisse dieses Prozesses privat angeeignet werden. Gewinne fließen nicht an die arbeitsteilige Gesamtheit, die sie erarbeitet, sondern an die Eigentümer der Produktionsmittel.
Daraus erwächst ein immer tieferer Widerspruch: Auf der einen Seite steht eine hochgradig vergesellschaftete, international verflochtene Produktion; auf der anderen Seite eine immer stärker konzentrierte, private Aneignung der Profite.
Je weiter die Vergesellschaftung fortschreitet, desto deutlicher wird, dass der Zweck dieser gesellschaftlichen Arbeit nicht die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse, sondern die private Kapitalverwertung ist.
Imperialismus als Notwendigkeit
Während die einzelnen Kapitalisten im Wettbewerb stehen – jeder für sich, gelegentlich auch in Kooperation – und dabei das Grundschema G–W–G′ verfolgen, hat der Staat ein Interesse am Gesamtprozess der Kapitalverwertung innerhalb seiner Grenzen.
Für ihn darf nicht nur das eine oder andere Unternehmen profitabel sein; vielmehr muss der Kapitalismus als Ganzes erfolgreich und produktiv bleiben. Nur so verfügt er über die materiellen Mittel, seine eigene Souveränität zu sichern.
Er tritt damit auch nach außen als ideeller Gesamtkapitalist auf.
Hieraus ergibt sich ein grundlegender Widerspruch. Der Staat setzt sein Gewaltmonopol innerhalb eines klar abgegrenzten Territoriums durch, doch der Zweck, den er betreut – die Kapitalvermehrung – kennt seiner Natur nach keine Grenzen.
Kapital will nicht bloß „auskommen“, sondern wachsen, und zwar schrankenlos.
Der maßlose Drang nach immer mehr Wachstum steht im Widerspruch zur endlichen Möglichkeit der Kapitalakkumulation am eigenen Standort.
Ein Staat, der die Kapitalakkumulation auf sein Territorium beschränkt, reduziert damit seinen eigenen Erfolg. Früher oder später reichen die nationalen Ressourcen nicht mehr aus, um den Bedarf des Kapitals nach Absatzmärkten, Investitionsmöglichkeiten, Rohstoffen, Energiequellen oder Transportwegen zu decken.
Das lässt sich gut am Beispiel der deutschen Energieversorgung zeigen:
Deutschland verfügt selbst über kaum nennenswerte fossile Energievorkommen. Dennoch ist eine stabile, verlässliche und günstige Energieversorgung eine Grundvoraussetzung für jede kapitalistische Volkswirtschaft – denn nahezu jeder Produktionsprozess, jede Transportkette und jedes digitale System hängt von Energie ab. Damit der Produktionsapparat des deutschen Kapitals reibungslos funktioniert, musste der deutsche Staat seit jeher sicherstellen, dass diese Energie aus dem Ausland bezogen werden kann – und zwar zu Preisen und Bedingungen, die seine industrielle Konkurrenzfähigkeit erhalten.
So entstanden enge ökonomische und politische Abhängigkeiten – jahrzehntelang etwa von russischem Erdgas, aber auch von globalen Öl- und LNG-Märkten, die durch US-amerikanische, arabische oder norwegische Produzenten dominiert werden. Diese Abhängigkeit ist keine zufällige Fehlentwicklung, sondern Ausdruck des beschriebenen Widerspruchs. Der deutsche Staat kann seine ökonomische Grundlage – das Wachstum des nationalen Kapitals – nur sichern, indem er über die Grenzen seines Territoriums hinaus auf Ressourcen anderer Staaten zugreift.
Gleichzeitig muss er dabei die Souveränität dieser Staaten respektieren, die ihrerseits über dieselben Ressourcen verfügen und sie für ihre eigenen nationalen Zwecke nutzen wollen.
Die Energiefrage ist also kein technisches Problem, sondern eine politische:
Sie verweist auf das strukturelle Verhältnis, in dem Staaten gezwungen sind, ihre ökonomische Basis über fremde Territorien abzusichern – und damit immer auch die Verfügung anderer Staaten über deren Ressourcen infrage zu stellen.
Darin zeigt sich exemplarisch, wie die kapitalistische Logik der grenzenlosen Akkumulation den Staat notwendig in Konkurrenz und Abhängigkeit zu anderen Souveränen versetzt. Wie sich Abhängigkeiten entwickeln und wie genau der Weltmarkt aussieht, kommt später mehr.
Staatliche Konkurrenz
Die schrankenlose Logik der Kapitalvermehrung führt Staaten daher unvermeidlich in Konkurrenz. Es reicht nicht, das eigene Kapital zu fördern; ebenso entscheidend ist es, die Verfügungsmöglichkeiten anderer Souveräne einzuschränken, sie vom Zugriff auf Märkte und Ressourcen auszuschließen und ihnen Bedingungen zu diktieren, die dem eigenen Kapital Vorteile verschaffen. Fremdes Territorium wird dann zur Quelle des eigenen Reichtums erklärt – und auch entsprechend behandelt.
Darin liegt der Kern des Imperialismus. Er ist nicht Ausdruck individueller Gier oder moralischer Verfehlung einzelner Politiker, sondern die notwendige Form, in der sich die Staatenwelt organisiert, sobald jedes nationale Gewaltmonopol denselben schrankenlosen Zweck verfolgt. Imperialismus bedeutet die Durchsetzung des eigenen nationalen Zwecks – Kapitalvermehrung und Machterhalt – über die Grenzen des eigenen Territoriums hinaus.
Zusammenfassung
Kapitalisten stehen im Wettbewerb um Absatzmärkte und Profite. Ihr Zweck ist die Kapitalakkumulation – die ständige Vermehrung des eingesetzten Geldes. Der bürgerliche Staat macht sich diesen Prozess zunutze, um seinen eigenen Bestand zu sichern und sich aus dem gesellschaftlich produzierten Reichtum zu finanzieren.
Deshalb tritt er als ideeller Gesamtkapitalist nach innen auf: Er schützt das Privateigentum, setzt die kapitalistische Produktionsweise durch und sorgt für die Bedingungen der Kapitalverwertung.
Der maßlose Zweck des Kapitals, sich zu verwerten, steht im Widerspruch dazu, dass die Welt in Nationalstaaten eingeteilt ist und diese territorial nur endliche Möglichkeiten dem Kapital bieten können.
Um seinen Erfolg nicht zu begrenzen, tritt der Staat auch nach außen als ideeller Gesamtkapitalist auf, um nicht die Vermehrung einer Kapitalfraktion zu garantieren, sondern die fremden Herrschaftsgebiete für die Bereicherung des gesamten nationalen Kapitals zu nutzen.
Das führt ihn zwangsläufig in Konkurrenz zu anderen Staaten, die denselben Zweck verfolgen.
Fremdes Territorium, fremde Ressourcen und fremde Märkte werden so zum Gegenstand staatlicher Verfügungskämpfe. Daraus ergibt sich die weltweite Konkurrenz der Staaten – ein strukturelles Verhältnis, das nicht auf Missverständnissen oder Fehlentscheidungen einzelner Politiker beruht, sondern aus dem Widerspruch von Staatszweck und Nationalstaat selbst hervorgeht.
Wie genau diese Konkurrenz ausgetragen wird – wirtschaftlich, politisch und schließlich auch militärisch – werden wir uns im Folgenden ansehen.
Weltmarkt und Friedensordnung
Der Widerspruch zwischen der maßlosen Kapitalvermehrung und den nationalstaatlichen Schranken führt nicht unmittelbar und automatisch zu Kriegen.
Krieg ist in der modernen Staatenwelt vielmehr das letzte Mittel, wenn alle anderen Formen der Durchsetzung nicht mehr greifen oder nicht ausreichen.
Die Außenpolitik moderner Staaten vollzieht sich im Normalfall in drei Schritten:
Anerkennung, Einschränkung und – im äußersten Fall – eine militärische Auseinandersetzung.
Anerkennung und Einschränkung
Anerkennung fremder Souveränität
Alle Staaten sind souveräne Gewaltmonopole über ihren je national beschränkten Kapitalismus. Sie begegnen sich nach außen – wie schon gesagt – als Letztentscheider, ohne dass es eine Gewalt gäbe, die über allen Staaten steht. Damit sie überhaupt in geregelte Beziehungen treten können, müssen sie sich daher zunächst formal anerkennen.
Diese Anerkennung ist keine moralische Geste, sondern die Voraussetzung für Außenwirtschaft: Ohne sie gäbe es keine Handelsverträge, Kreditbeziehungen oder Investitionsabkommen. Außenpolitik beginnt also nicht mit Feindschaft, sondern mit der Anerkennung fremder Herrschaft – allerdings immer im Hinblick auf deren Nutzung für die eigene Kapitalakkumulation. Staaten ziehen aus ihrem Interesse an Kapitalvermehrung die Konsequenz, sich als Akteure im Weltmarkt zu begreifen und fremde Souveränität so weit anzuerkennen, wie sie den eigenen Zugriff auf Ressourcen, Arbeitskräfte und Märkte ermöglicht.
Man kann sich fragen: Was würde es bedeuten, wenn diese Anerkennung verweigert würde? Das wäre gleichbedeutend mit einem dauerhaften Kriegszustand. Denn wer auf Ressourcen und Arbeitskräfte einer fremden Nation zugreifen will, ohne deren Anspruch als Letztentscheider anzuerkennen, greift damit direkt die Souveränität dieses Staates an. Eine solche Missachtung bedeutet, dass es keine Grundlage für Verhandlungen oder Verträge gibt. Dann bleibt nur noch die gewaltsame Entscheidung: ein militärischer Vergleich, in dem geklärt wird, wer über das betreffende Territorium und seine Nutzung bestimmt.
Am Ende gilt eben, dass politische Macht aus den Gewehrläufen kommt.
Gerade weil das so ist, will kein Staat die permanente Kriegsform. Zur Klarstellung: Jeder Staat tritt nach außen mit dem Interesse auf, seinem eigenen nationalen Kapitalismus mehr Möglichkeiten zur Kapitalakkumulation zu erschließen.
Ein dauerhafter Kriegszustand wäre diesem Zweck völlig entgegengesetzt – denn darin fände gerade keine kapitalistische Nutzung nach innen und außen statt.
Deswegen ist die Anerkennung fremder Souveränität die Grundlage für alle internationalen Beziehungen: Sie macht den geregelten Zugriff möglich, auch wenn die praktische Einschränkung dieser Souveränität das unausweichliche Ziel bleibt.
Also nochmal kurz: Damit kapitalistische Benutzung stattfinden kann, müssen sich die Staaten anerkennen.
Unterscheidung Staat nach Innen und nach Außen
Hier lässt sich schon eine wichtige Unterscheidung treffen.
Nach innen gilt das Recht des Stärkeren in Gestalt des staatlichen Gewaltmonopols. Der Staat ist hier die letzte Instanz in allen Konflikten. Wo Bürger einander Ansprüche streitig machen, entscheidet letztlich die staatliche Gewalt, wessen Recht gilt – notfalls mit Polizei, Gerichten und Armee. Dass „politische Macht aus den Gewehrläufen kommt“, heißt nichts anderes, als dass die staatliche Ordnung nicht auf Konsens oder Moral beruht, sondern auf Gewalt, die den Gesetzen überhaupt erst Geltung verschafft. Wer diese Gewalt herausfordert, stellt sich gegen die höchste Instanz und kann entsprechend niedergehalten werden.
Nach außen hingegen gilt nicht das Gewaltmonopol des Staates, sondern das Recht des Stärkeren. Zwischen souveränen Staaten existiert keine übergeordnete Macht, die verbindlich entscheidet, wie zwischen Bürgern im Inneren. Die wechselseitige Anerkennung staatlicher Gewaltmonopole beruht nicht darauf, dass die Ansprüche der Staaten geklärt wären – im Gegenteil: Ihre Nutzungsansprüche an Ressourcen, Märkten und Territorien widersprechen einander und blockieren sich gegenseitig.
Es gibt zwar internationales Recht, Verträge und Institutionen, doch deren Wirksamkeit hängt am Kräfteverhältnis. Ökonomisch und militärisch überlegene Staaten können ihre Interessen global durchsetzen, schwächere müssen sich fügen.
Außenpolitik bewegt sich daher in einem Feld permanenter Konkurrenz, in dem nicht die Rechtsform, sondern die Fähigkeit zur Gewalt – ökonomisch wie militärisch – den Ausschlag gibt.
Kurzer Hinweis zum Völkerrecht:
Staaten sind im internationalen System zugleich Spieler und Schiedsrichter der Konkurrenz. Ihre Gegensätze prallen strukturell aufeinander, und das Völkerrecht bietet lediglich den Rahmen, diese Konflikte in rechtliche Formen zu überführen.
Doch die Regeln werden nicht von einer neutralen, übergeordneten Instanz gesetzt, sondern von den mächtigeren Staaten geprägt und angewandt – und zwar dann, wenn es ihren Interessen dient.
Das Völkerrecht ist daher kein Mittel, die Konkurrenz der Staaten zu überwinden, sondern ein Instrument, sie zu organisieren und zugleich ideologisch zu bemänteln.
Mehr dazu findet ihr in unserer kleinen Broschüre „Mythos Völkerrecht: Fassade des Imperialismus“.
Wie sieht diese abstrakte Anerkennung aus?
Die Anerkennung der souveränen Gewalten läuft zunächst über die Rechtsform des Vertrags. Staaten schließen etwa Handelsverträge oder Kulturabkommen.
Die erste Botschaft lautet immer: Wir erkennen an, dass es diese fremde Gewalt gibt, und akzeptieren ihre Herrschaft über das jeweilige Territorium.
Damit Staaten solche Beziehungen überhaupt pflegen können, sind sie auf ein Mindestmaß an Vertrauen angewiesen – doch beide Partner deuten die Verträge nach ihrem eigenen Vorteil.
Dabei muss man klarstellen, dass es sich hier nicht um einen Zustand „gegenseitigen Nutzens“ handelt, wie ihn die Imperialisten gern beschwören.
In Wahrheit konkurrieren hinter den Staaten ihre nationalen Kapitale – mit Ansprüchen auf Ressourcen, Absatzmärkte und Investitionsmöglichkeiten –, während die Staaten selbst den Erfolg ihres jeweiligen Kapitals betreuen.
Wenn sich dabei einer durchsetzt, bedeutet der Vorteil des einen fast immer den Nachteil des anderen. Auf staatlicher Ebene entstehen so Gewinner und Verlierer: Staaten, deren nationaler Reichtum durch die Teilnahme an der Konkurrenz im Weltmarkt wächst – und solche, deren Reichtum schrumpft.
An dieser Stelle beginnt das Verhältnis der Abhängigkeit.
Denn die formale Anerkennung zwischen souveränen Staaten ändert nichts daran, dass die materielle Grundlage dieser Beziehungen ungleich ist.
Wirtschaftlich stärkere Mächte können ihre Position nutzen, um anderen Staaten Bedingungen aufzuzwingen – Kredite, Investitionsauflagen, Rohstoffpreise oder Handelsverträge, die den schwächeren Teil dauerhaft in ein Abhängigkeitsverhältnis bringen.
Die „Anerkennung“ verwandelt sich so in eine Beziehung, in der die Souveränität der Unterlegenen zwar formal bestehen bleibt, praktisch aber von den Interessen der Stärkeren abhängt.
Diese Abhängigkeit ist kein Betriebsunfall der Weltordnung, sondern ihre normale Funktionsweise:
Formelle Gleichheit bei realer Ungleichheit, rechtliche Anerkennung bei ökonomischer Unterordnung.
Einschränkung fremder Souveränität
Die Anerkennung fremder Souveränität ist, wie wir gesehen haben, kein Selbstzweck.
Sie ist nur die Grundlage dafür, das fremde Gewaltmonopol für die eigenen Zwecke nutzbar zu machen.
Genau aus den Abhängigkeiten, die durch Weltmarkt, Handel und Kreditbeziehungen entstehen, erwächst der Zwang zur politischen Einflussnahme.
Denn ein Staat, der durch ökonomische Mittel über andere verfügt, will auch sicherstellen, dass diese Abhängigkeit bestehen bleibt – und notfalls politisch oder militärisch abgesichert wird.
Diese Einschränkung fremder Souveränität nimmt verschiedene Gestalten an.
Ökonomisch bedeutet sie, dass schwächere Staaten ihre Märkte öffnen, Zölle senken und ihre Rohstoffe zu Bedingungen verkaufen müssen, die dem Kapital der stärkeren Nationen dienen.
Politisch zeigt sie sich darin, dass Gesetze, Haushalte und Investitionsprogramme an die Vorgaben internationaler Institutionen wie IWF oder Weltbank gebunden werden – Institutionen, die formal als „neutral“ auftreten, in Wirklichkeit aber die Interessen der ökonomisch mächtigsten Staaten organisieren.
Ein deutliches Beispiel dafür ist die sogenannte Schuldenkrise Griechenlands ab 2010.
Als Griechenland nach der globalen Finanzkrise seine Staatsschulden nicht mehr bedienen konnte, griffen EU, EZB und IWF ein.
Sie stellten Kredite bereit – aber nur unter der Bedingung, dass die griechische Regierung ein umfangreiches „Reformprogramm“ umsetzt.
Das bedeutete: Kürzungen im öffentlichen Dienst, Massenentlassungen, Privatisierungen, Lohn- und Rentensenkungen.
Offiziell wurde dieses Programm als „Stabilisierung“ oder „Hilfe“ verkauft.
In Wahrheit diente es der Sicherung der Ansprüche europäischer Banken und der Wiederherstellung der Zahlungsfähigkeit gegenüber den Gläubigerstaaten – allen voran Deutschland und Frankreich.
Während Griechenland formal ein souveräner Staat blieb, wurde seine Finanz- und Haushaltspolitik de facto von außen bestimmt.
Über zentrale politische Entscheidungen – über Ausgaben, Steuern, Investitionen – entschieden nicht mehr die gewählten Vertreter des Landes, sondern Institutionen, die den Interessen der stärksten europäischen Ökonomien verpflichtet waren.
Das Beispiel zeigt exemplarisch den inneren Widerspruch dieser Ordnung:
Die Souveränität wird formal anerkannt, aber materiell aufgehoben.
Ein Staat darf seine Unabhängigkeit nur in dem Maße behalten, wie er sie einschränkt, um am Weltmarkt teilnehmen zu können.
Je stärker er auf Kredite, Märkte und Investitionen angewiesen ist, desto stärker wird seine Politik den Interessen der ökonomisch Überlegenen unterworfen.
Darin liegt das eigentliche Paradox der imperialistischen Diplomatie:
Jeder Staat wird als souverän anerkannt – aber genau in dem Maße, wie er diese Souveränität beschneidet, um im Weltmarkt bestehen zu können.
Anerkennung, Abhängigkeit und Einschränkung sind keine Gegensätze, sondern aufeinander aufbauende Stufen derselben Bewegung.
Und solange die Methoden wirtschaftlicher Erpressung, diplomatischer Verhandlungen und institutioneller Kontrolle ausreichen, bleibt diese Konkurrenz „eingefriedet“ – das heißt: Sie erscheint als friedliche Kooperation, obwohl sie auf ungleicher Macht beruht.
Doch diese „Einfriedung“ ist instabil.
Sobald die ökonomischen oder politischen Mittel zur Sicherung der bestehenden Abhängigkeiten an ihre Grenzen stoßen, tritt die Gewalt offen hervor.
Dann zeigt sich, dass der sogenannte Frieden der Staatenwelt nur die verwaltete Form eines dauerhaften Konkurrenzverhältnisses ist.
Zwischenbilanz: Die Logik der kapitalistischen Staatenwelt
Wir haben gesehen, dass die Staatenwelt keine Gemeinschaft freier und gleichberechtigter Akteure ist, sondern ein System, das durch Widersprüche strukturiert ist.
Jeder Staat verfolgt denselben Zweck: die Vermehrung des nationalen Kapitals. Damit steht er notwendig in Konkurrenz zu allen anderen Staaten, die genau dasselbe Ziel verfolgen.
Die Grundlage dieser Konkurrenz ist zunächst die formale Anerkennung der Souveränität.
Diese Anerkennung schafft den rechtlichen Rahmen, innerhalb dessen kapitalistische Nutzung überhaupt stattfinden kann.
Doch in der Realität bedeutet sie keine Gleichheit, sondern öffnet den Raum für ungleiche Durchsetzung: wirtschaftlich stärkere Staaten sichern sich Vorteile, während schwächere in Abhängigkeiten geraten.
Diese Abhängigkeiten sind nicht zufällige Fehlentwicklungen, sondern die normale Funktionsweise des Weltmarkts.
Sie drücken aus, dass die kapitalistische Konkurrenz auf staatlicher Ebene immer Gewinner und Verlierer hervorbringt – und dass die formelle Gleichrangigkeit der Staaten nur die politische Form einer materiell ungleichen Weltordnung ist.
Aus dieser Ungleichheit erwächst der nächste Schritt:
Wer Abhängigkeiten herstellt, muss sie auch sichern.
Ökonomische Dominanz will politisch garantiert und militärisch abgesichert werden.
Genau hier wird das Militär zum notwendigen Bestandteil staatlicher Macht – nicht als Ausnahme, sondern als Mittel, um die imperialistische Ordnung aufrechtzuerhalten.
Was ist überhaupt dieser Weltmarkt?
Der Weltmarkt ist die Gesamtheit der kapitalistischen Produktion und des Handels, soweit sie über nationale Grenzen hinausgeht. Er entsteht nicht, weil sich Menschen weltweit friedlich austauschen wollen, sondern weil das Kapital einen inneren Zwang zum Wachstum hat. Kapital will nicht einfach bestehen, sondern sich ständig vermehren. Dafür braucht es immer neue Absatzmärkte, Rohstoffe, Arbeitskräfte und Investitionsmöglichkeiten.
Keine nationale Wirtschaft kann all das allein bereitstellen. Deshalb dehnt sich die kapitalistische Produktion von Anfang an über Grenzen hinweg aus – zuerst durch Handel, dann durch Kolonialismus, später durch internationale Finanz- und Industrienetze. Der Weltmarkt ist also kein natürliches Ergebnis menschlicher Arbeitsteilung, sondern das Resultat der Ausdehnung kapitalistischer Konkurrenz auf den gesamten Globus.
Auf dem Weltmarkt begegnen sich die Staaten nicht als neutrale Vermittler, sondern als Vertreter ihrer jeweiligen nationalen Kapitalinteressen. Jeder Staat versucht, die Bedingungen seiner Kapitalverwertung zu verbessern – durch Handelsabkommen, Zölle, Währungsregeln, Investitionsschutz oder militärische Einflusszonen.
Formal sind alle Staaten gleichberechtigt, weil jeder souverän über sein Territorium verfügt. In der Realität aber sind sie höchst ungleich: Manche kontrollieren zentrale Ressourcen, Produktionsmittel oder Finanzströme, andere sind davon abhängig.
So entsteht eine Hierarchie der Staaten, in der die ökonomisch und militärisch Stärkeren bestimmen, nach welchen Regeln der Weltmarkt funktioniert.
Besonders deutlich wird das an der Rolle der USA nach dem Zweiten Weltkrieg.
Als ökonomisch und militärisch stärkste Macht schufen sie die Institutionen, die bis heute die globale Ordnung strukturieren: den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank und das Dollarsystem, das den US-Dollar zur Leitwährung des Weltmarkts machte. Weil zentrale Güter – insbesondere Energie und Rohstoffe – in Dollar gehandelt werden, sind fast alle Staaten gezwungen, ihre Devisenreserven in dieser Währung zu halten.
Das verschafft den USA einen strukturellen Vorteil: Sie können sich in ihrer eigenen Währung verschulden, während andere Staaten ihre Ökonomien an die Stabilität des Dollars binden müssen. Zugleich erlaubt es ihnen, ökonomische Macht in politische Kontrolle zu übersetzen. Wenn die USA Sanktionen verhängen, können sie Banken und Unternehmen weltweit vom Dollarhandel ausschließen – und damit ganze Volkswirtschaften lahmlegen, ohne militärisch eingreifen zu müssen.
So geschehen etwa im Fall des Iran, der durch den Ausschluss vom internationalen Zahlungsverkehr (SWIFT-System) seine Haupteinnahmequelle – den Ölhandel – weitgehend verlor. Ähnlich im Fall Russlands nach 2022, als der Zugang zu westlichen Finanzmärkten blockiert und Vermögenswerte eingefroren wurden.
Solche Maßnahmen werden als „Verteidigung der internationalen Ordnung“ bezeichnet, dienen aber in Wahrheit der Aufrechterhaltung einer Hierarchie, in der die USA als ökonomisches und politisches Zentrum fungieren.
Der sogenannte Freihandel ist also keine friedliche Kooperationsform, sondern die institutionalisierte Durchsetzung der Bedingungen, unter denen die stärksten Mächte ihre Kapitalinteressen global geltend machen.
Die Freiheit des Handels besteht nur für jene, die die Macht haben, sie zu definieren.
Darin zeigt sich der grundlegende Widerspruch des Weltmarkts:
Jeder Staat will souverän über seine Ökonomie verfügen, ist dafür aber auf ein System angewiesen, das von den Mächtigsten beherrscht wird. Der Versuch, ökonomisch unabhängig zu werden, führt so zwangsläufig in neue Abhängigkeiten.
Die Staaten öffnen ihre Ökonomien, um stärker zu werden – und machen sich dadurch erpressbar. Der Weltmarkt verbindet alle Nationen durch Handel und Kapitalströme, stellt sie aber zugleich in ein Verhältnis permanenter Konkurrenz, in dem jede versucht, ihre Position auf Kosten der anderen zu verbessern.
So ist der Weltmarkt kein Gegenentwurf zur Gewaltpolitik, sondern ihre Grundlage.
Seine Regeln, Hierarchien und Institutionen beruhen von Anfang an auf staatlicher Gewalt – heute vor allem auf der Fähigkeit der USA, diese Ordnung ökonomisch, politisch und militärisch durchzusetzen.
Notwendigkeit des Militärs
Die gegensätzlichen und ausschließenden Interessen der Staaten sind den Politiker:innen wohlbekannt. Jeder Staat will seine Anliegen durchsetzen – am liebsten mit Zustimmung der anderen, auch wenn diese dadurch Nachteile in Kauf nehmen müssen. Doch diese Zustimmung ist nie selbstverständlich, sondern das Ergebnis von Druck, Erpressung und Abhängigkeit. Und genau hier zeigt sich, dass selbst die „friedliche“ Konkurrenz immer ein Verhältnis der Gewalt bleibt.
Wenn Staaten miteinander verhandeln, dann nie auf einer neutralen Basis.
Hinter jeder diplomatischen Geste steht die Frage, wer die Macht hat, seine Interessen notfalls auch ohne Zustimmung durchzusetzen. Die „Waffen der Konkurrenz“ sind zunächst ökonomisch – Kapitalexporte, Kredite, Handelsprivilegien oder Sanktionen –, aber sie funktionieren nur, weil sie von der Möglichkeit physischer Gewalt gedeckt sind. Erst die Aussicht, diese Macht auch militärisch durchsetzen zu können, verleiht den politischen und wirtschaftlichen Ansprüchen ihr Gewicht.
Staaten wissen also, dass ihre Anerkennung durch andere nie selbstverständlich ist, sondern jederzeit verweigert werden kann. Damit sie ihren nationalen Zweck – die Kapitalvermehrung – trotzdem sichern können, müssen sie die Fähigkeit besitzen, sich gegen andere Gewalten zu behaupten. Diese Fähigkeit ist das Militär.
Es ist die materielle Garantie der Souveränität, die Instanz, auf die sich der politische Wille im äußersten Fall stützt.
Hier zeigt sich der Sinn des bekannten Satzes:
„Die politische Macht kommt letztendlich aus den Gewehrläufen.“
Er beschreibt nicht nur den Krieg, sondern das Prinzip jeder staatlichen Ordnung – nach innen wie nach außen. Nach innen sichert das Gewaltmonopol das Privateigentum und den gesellschaftlichen Zwang zur Arbeit; nach außen sichert das Militär die Verfügung über die nationalen Reichtumsquellen und den Zugang zu fremden.
Das Militär ist also kein Ausnahmeinstrument für Krisenzeiten, sondern notwendiger Bestandteil der kapitalistischen Staatenkonkurrenz.
Es verkörpert die letzte Instanz, auf die sich jede politische Macht stützt.
Ohne es wäre weder der sogenannte Frieden haltbar noch die Ordnung des Weltmarkts aufrechtzuerhalten.
Fazit
Wenn Staaten ihre Machtverhältnisse stabilisiert haben, nennen sie das Frieden.
Doch dieser Frieden ist keine friedliche Alternative zum Krieg, sondern dessen Voraussetzung und ständige Fortsetzung mit anderen Mitteln.
Der sogenannte Frieden ist die organisierte Form imperialistischer Herrschaft:
Die militärischen Fronten sind eingefroren, die ökonomischen Abhängigkeiten festgeschrieben, die politischen Machtverhältnisse anerkannt.
In diesem Zustand wird Gewalt nicht abgeschafft, sondern institutionell verwaltet.
Grenzen werden bewacht, Aufrüstungsprogramme beschlossen, Militärbündnisse gepflegt. Die Drohung mit Gewalt – also das, was Frieden überhaupt garantiert – bleibt immer präsent. Deshalb ist der Frieden in der kapitalistischen Staatenwelt kein Zustand des Einvernehmens, sondern der temporäre Stillstand zwischen zwei Phasen offener Gewalt.
Wenn die bestehende Ordnung der Abhängigkeiten infrage gestellt wird, wenn Verträge gebrochen oder Interessen neu verteilt werden sollen, tritt die Gewalt offen hervor. Dann zeigt sich, dass der Krieg nicht das Scheitern des Friedens ist, sondern seine Wahrheit. Der Krieg ist die offene Form dessen, was im Frieden strukturell schon existiert: der Zwang, sich durchzusetzen – auch mit militärischen Mitteln.
Genau in diesem Sinn trifft das Zitat von Tarek K.I.Z.:
„Wir sind gegen ihren Krieg und gegen ihren Frieden.“
Es bringt in einer Zeile auf den Punkt, was die Analyse gezeigt hat:
Beides – Krieg wie Frieden – gehört zur gleichen Ordnung. Der „Frieden“ der kapitalistischen Staatenwelt ist kein Gegensatz zum Krieg, sondern seine Fortsetzung unter anderen Vorzeichen. Gegen ihren Krieg zu sein, heißt deshalb auch, den ihren Frieden abzulehnen – eine Weltordnung, die auf Ausbeutung, Abhängigkeit und Gewalt basiert.
Eine wirkliche Friedensperspektive beginnt erst dort, wo diese Ordnung selbst aufgehoben wird – wo also nicht nur der Krieg, sondern auch der Frieden dieser Weltordnung überwunden wird.